 3D-Box
3D-BoxSchon immer haben 3D-Bilder den Betrachter fasziniert. Einem breiten Publikum sind die ViewMaster Bilder bekannt. Auch das Anaglyphenverfahren mit Betrachtung der Stereobildpaare durch eine rot/grün oder rot/blau Brille ist weithin geläufig. Aufgrund des Einsatzes von Computertechnologien werden der räumlichen Bildbetrachtung neue Möglichkeiten eröffnet. Digitalisierte Photos und virtuelle photorealistische Renderings können als Halbbilder dienen. Die Bilder können als Anaglyphen oder in interlaced Technik berechnet werden. Zusätzlich zu den statischen Bildern sind Panoramen und Animationen für die Stereodarstellung geeignet. Plug-ins für Internetbrowser sorgen für die weltweite Verbreitung der Bilder.
1 Räumliches Sehen
Die Augenlinse entwirft auf der Netzhaut ein zweidimensionales Bild räumlicher Objekte. Bei einäugiger Betrachtungsweise ermöglichen besondere Erfahrungsmerkmale, wie geometrische Perspektive oder die Überdeckung von Objekten Rückschlüsse auf die räumliche Gliederung des Gesehenen. Die Wirkung der monokularen Tiefenerkennung erreicht jedoch nicht die Differenzierung der binokularen Tiefenwahrnehmung. Jedes Auge empfängt ein Netzhautbild, das dem anderen, resultierend aus dem Augenabstand, nicht völlig gleich ist, sondern eine andere Perspektive aufweist. Beide Bilder verschmelzen durch das Fusionsvermögen des Auges zum Raumbild.
Grundlage des stereoskopischen Sehens ist der Vergleich dieser unterschiedlichen Bilder. Ein physiologisches Maß für die Empfindung der Tiefenunterschiede ist die Querdisparation, die geometrisch durch die stereoskopische Parallaxe ausgedrückt werden kann. Das Tiefenwahrnehmungsvermögen nimmt quadratisch zur Entfernung ab, ist jedoch auf kurze Entfernungen außerordentlich hoch. Beim künstlichen stereoskopischen Sehen kann unter Verzicht auf die Natürlichkeit der Betrachtung das Tiefenwahrnehmungsvermögen durch Vergrößerung der Betrachtungsbasis oder optische Vergrößerung der Bilder gesteigert werden.
Der Raumeindruck kann künstlich hervorgerufen werden, wenn beiden Augen gleichzeitig nur die getrennten Bilder der Vorlage zugeführt werden. Die Eigenschaften der Bilder müssen dem Eindruck des natürlichen Sehens entsprechen. Man erreicht dieses durch Zentralprojektionen mit paralleler Betrachtungsrichtung.


2 Aufnahme von Stereobildpaaren
Stereophotos können mit einer Stereokamera, zwei Kameras gleicher Bauart mit Synchronauslösung oder mit einer Kamera montiert auf einer Stereoschiene aufgenommen werden. Letzere Lösung gestattet nicht die Aufnahme bewegter Objekte. Hochwertige Stereokameras haben ihren Preis und einen festen Objektivabstand, der in etwa dem Augenabstand entspricht. Ein einfacheres Exemplar einer Stereokamera ist das Modell FED Stereo mit einem Bildformat von 31*24 mm und Objektiven mit einer Brennweite von 28 mm im Abstand von 65 mm. Bei der Benutzung einer auf einer Stereoschiene montierten Kamera ist die Wahl eines geeigneten Basisverhältnisses erforderlich. Generell gilt die 1:30 Regel Faustregel. Bei einer Aufnahmeentfernung von 6 m wäre der Objektivabstand mit 20 cm anzunehmen.
Grundlage des stereoskopischen Sehens ist der Vergleich dieser unterschiedlichen Bilder. Ein physiologisches Maß für die Empfindung der Tiefenunterschiede ist die Querdisparation, die geometrisch durch die stereoskopische Parallaxe ausgedrückt werden kann. Das Tiefenwahrnehmungsvermögen nimmt quadratisch zur Entfernung ab, ist jedoch auf kurze Entfernungen außerordentlich hoch. Beim künstlichen stereoskopischen Sehen kann unter Verzicht auf die Natürlichkeit der Betrachtung das Tiefenwahrnehmungsvermögen durch Vergrößerung der Betrachtungsbasis oder optische Vergrößerung der Bilder gesteigert werden.
Berechnung der Basis
Die Wahl der Basis wird beeinflusst von der Ausdehnung des Objektes, der Brennweite und der Bildgröße bzw Bildvergrößerung. Eine generelle Berechnungsformel nach [2] ist wie folgt formuliert :
b = d * (( af * an ) / (af-an) * (1/f - 1/a)
mit folgenden
Bezeichnungen:
an Abstand zum nächsten Punkt af Abstand zum
entferntesten Punkt
f Brennweite
a Abstand Projektionszentrum maximale
Scharfabbildungsebene
d Differenz der Bildabstände des Nahpunktes und
des Fernpunktes,
Für 35 mm Filmformat gilt als maximal
zulässiger Wert 1,2 mm. Bei Mittelformaten sind Werte kleiner 2,5 mm
zulässig.
Ein Berechnungsbeispiel für diese Gleichung: Der Abstand zum
nächsten Punkt beträgt 2 m, die weiteste Entfernung beträgt 4 m.
Aufgenommen wird mit einer Brennweite von 50 mm, fokussiert auf 2,6 m, die
maximale Parallaxe wird mit d = 1,2 mm angenommen. Hieraus folgt ein
Bildabstand von:
b = 0,0012 m *((4 m * 2 m) / (4 m - 2 m)) * ( 1/ 0,05 m -
1/ 2,6 m) = 94 mm
Nach der 1:30 Regel wäre ein Basisabstand bei mittlerer Aufnahmeentfernung von 3m mit 100 mm zu wählen.


3 Berechnung stereoskopischer Bildpaare
Zur Erzeugung stereoskopischer Abbildungen einer virtuellen Welt mit einem CAD-System kann man wie folgt vorgehen: Zunächst erhält man über die Voransichtsfunktionen Näherungswerte für die Abbildungsdaten. Hiernach konstruiert man die Betrachtungsrichtung, ermittelt den Abstand zum Objekt und berechnet die Basislänge nach der allgemeinen Formel oder der 1:30 Faustregel. Die Aufnahmerichtung wird dann durch Parallelverschiebung um die halbe Basislänge nach rechts und links kopiert. Bei der Festlegung der Perspektive liegen somit Standpunkte und Blickpunkte für die beiden Halbbilder vor. Ist die Aufnahmerichtung nicht horizontal legt man ggf. ein lokales Koordinatensystem in die Aufnahmeebene. Durch Layersteuerung entfernt man die Hilfskonstruktionen vorübergehend. Auch bei der Beleuchtungssteuerung können die Konstruktionslinien hilfreich sein.
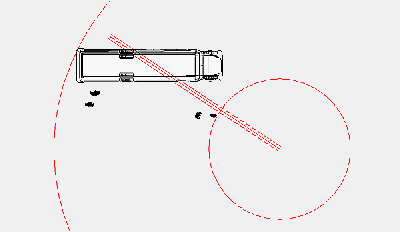
In der Abbildung sind die Aufnahmerichtungen des linken und
rechten Bildes sichtbar sowie die mittlere Aufnahmerichtung zur Ermittlung
einer geeigneten Voransicht.
Die Radien geben den Abstand zum Nahpunkt
und zum Fernpunkt an. Für die generelle Formel können folgende Werte
angesetzt werden : an = 5,3; af = 16,8; a = 11; mit d = 1,2 für ein
Kleinbildformat ergibt sich hieraus eine Basislänge von 0,36. Mit der 1:30
Regel wurde ein Basislänge von 0,38 m bestimmt.

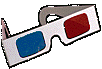
4 Betrachtung stereoskopischer Bildpaare
Es gibt zahlreiche Verfahren der optisch mechanischen Bildtrennung. Ein häufig angeandtes Prinzip entspricht dem eines Linsenstereoskopes. In der Abbildung 8 wird ein Schnitt durch das Linsenstereoskop gezeigt. Die Bilder befinden sich im Abstand der Brennweite vor den Linsen, hierdurch sind die austretenden Strahlen parallel. Der Beobachter sieht mit jeweils einem Auge die getrennt erzeugten Perspektiven. Beide Halbbilder werden wie eingangs beschrieben zu einem räumlichen Modell verschmolzen.

Das Anaglyphenverfahren basiert auf der Benutzung komplementärfabiger Halbbilder. Bei Betrachtung durch entsprechende Farbfilter sieht jedes Auge nur das zu seinem Farbfilter komplementärfarbige Bild.Handelsübliche Anaglypenbrillen gibt es in rot/blau und rot/ grün wobei i.d.R. der rote Farbfilter immer links ist. Mit einem RGB Anaglyphenbild können neben s/w Bildern auch farbige Abbildungen betrachtet werden, deren Qualität aber nicht immer optimal ist ist
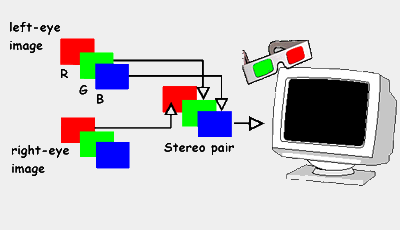
Ein RGB Bild besteht aus den Grundfarben rot, grün und
blau.Benutzt man vom rechten Bild nur die Farben grün und blau und
entfernt im linken Halbbild diese Farben, so dass hier nur der Rotanteil
vorhanden ist, dann wird bei entsprechender Überlagerung ein
Anaglyphenbild erhalten, das weiter alle drei Farbkanäle beinhaltet. Bei
Benutzung einer Anaglyphenbrille werden somit den Augen nur die jeweils
zugehörigen Halbbilder zugeführt. Anaglyphen können manuell mit
Bildbearbeitungsprogrammen wie PhotoShop erstellt werden. Schwarz-weiss Bilder
werden in rote und blaue Farben konvertiert und mit den entsprechenden Filtern
wieder separiert. Bei der Montage verschiebt man die Bilder gegenseitig, da in
der Bildebene keine Parallaxe auftritt ist der Tiefeneindruck
manipulierbar.

Die Benutzung von Shutter Brillen ist derzeit das populärste Verfahren für eine ansprechende Stereopräsentation in Farbe. Die Brillen werden mit hoher Frequenz, synchronisiert mit der Monitoranzeige gesteuert. Das Monitorbild wird entweder interlaced als Halbbild berechnet oder durch sog. Page-Flipping erzeugt. Hierbei werden die beiden Halbbilder mit unterschiedlicher Startadresse im Bildspeicher gehalten. Die Flüssigkristalle in der Brille haben die Eigenschaft, durch ein elektronisches Signal von transparent auf undurchsichtig zu wechseln. Sofern dieses mit entsprechender Frequenz geschieht ensteht ein ansprechendes räumliches Farbbild. Mit dem Vrex DepthCharge für Windows plug-in werden alle gängigen Stereoformate im Internetbrowser Netscape oder MSIE unterstützt.
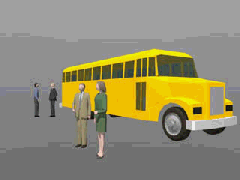
Referenzen - Literatur
Günter Pomaska
Stereo-Bilder, CHIP Mikrocomputermagazin
Jan. 1983
J.Bercovitz und Kiewa Valley Stereo
A Comparison of Camera
Base Calculation Methods,
http://werple.net.au/~kiewwavly/bases.html
A Short Course in Digital Photography
Chapter 12, Stereo
Photography
http://www.shortcourses.com/chapter12.htm
How to make 3D-pictures by computer
http://www.stereoscopy.com/3d-info/index.html